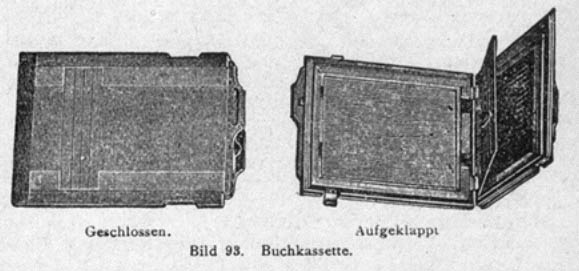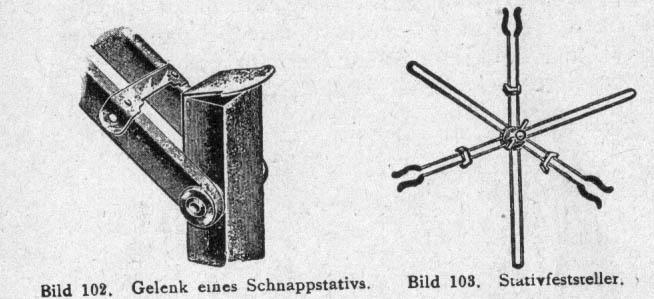VI. Die Kassetten.
 Zur
lichtdichten Verwahrung der Platte und zum Anbringen der
Platte am Apparat dienen die Kassetten. Nach der Art des
Einlegens der Platte unterscheidet man gewöhnliche:
in diese werden die Platten nach Herausziehen des Schiebers
von vorne eingelegt, Schichtseite der Platten nach oben,
und durch "Vorreiber" usw. festgehalten; dann
aufklappbare Kassetten, bei denen die Rückwand der
Kassette aufgeklappt und nun die Platte von hinten,
Schichtseite nach unten, eingelegt wird; diese Ausführung
ist besonders bei Atelierkameras (S.
37) üblich.
Zur
lichtdichten Verwahrung der Platte und zum Anbringen der
Platte am Apparat dienen die Kassetten. Nach der Art des
Einlegens der Platte unterscheidet man gewöhnliche:
in diese werden die Platten nach Herausziehen des Schiebers
von vorne eingelegt, Schichtseite der Platten nach oben,
und durch "Vorreiber" usw. festgehalten; dann
aufklappbare Kassetten, bei denen die Rückwand der
Kassette aufgeklappt und nun die Platte von hinten,
Schichtseite nach unten, eingelegt wird; diese Ausführung
ist besonders bei Atelierkameras (S.
37) üblich.
| Einfache und Doppelkassetten. |
 Manchmal
bei Atelierkameras, meist bei Reise- und Handkameras, ist
die Klappkassette eine Doppelkassette für zwei
Platten: eine solche "Buchkassette" (Bild
93) wird wie ein Buch auseinandergeklappt, und an jeder
Seite wird eine Platte, mit der lichtempfindlichen Seite
nach unten, hineingelegt. Beide Platten sind durch eine
geschwärzte Blechwand getrennt. Nach der Beschickung
mit Platten wird die Kassette zusammengeklappt und durch
Metallklemmen geschlossen. Das Belichten der Platten geschieht
bei allen Kassetten nach Herausziehen des Schiebers an der
dem Objektiv zugewendeten Seite.
Manchmal
bei Atelierkameras, meist bei Reise- und Handkameras, ist
die Klappkassette eine Doppelkassette für zwei
Platten: eine solche "Buchkassette" (Bild
93) wird wie ein Buch auseinandergeklappt, und an jeder
Seite wird eine Platte, mit der lichtempfindlichen Seite
nach unten, hineingelegt. Beide Platten sind durch eine
geschwärzte Blechwand getrennt. Nach der Beschickung
mit Platten wird die Kassette zusammengeklappt und durch
Metallklemmen geschlossen. Das Belichten der Platten geschieht
bei allen Kassetten nach Herausziehen des Schiebers an der
dem Objektiv zugewendeten Seite.
 Absolute
Lichtdichtigkeit der Kassetten ist unbedingt erforderlich
(häufig dringt bei schlecht gearbeiteten Kassetten
mit umlegbaren Schieber Licht durch das Scharnier). Man
prüft die Kassetten auf Lichtdichtigkeit, indem man
sie, mit Platten versehen, einige Minuten in die Sonne legt
und dann die Platten entwickelt; diese dürfen keine
Spur von Lichteindruck zeigen.
Absolute
Lichtdichtigkeit der Kassetten ist unbedingt erforderlich
(häufig dringt bei schlecht gearbeiteten Kassetten
mit umlegbaren Schieber Licht durch das Scharnier). Man
prüft die Kassetten auf Lichtdichtigkeit, indem man
sie, mit Platten versehen, einige Minuten in die Sonne legt
und dann die Platten entwickelt; diese dürfen keine
Spur von Lichteindruck zeigen.
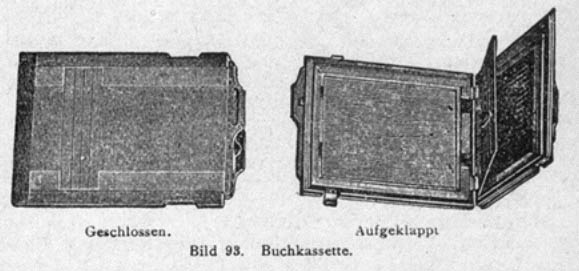
Auch die gewöhnlichen Kassetten
werden als Doppelkassetten ausgeführt.
 Bei
Stativapparaten werden vorwiegend Holzkassetten mit
jalousieartig zusammengesetzten Holzschiebern verwendet.
Solchen Schiebern haftet der prinzipielle übelstand
an, daß Holz, die zur Verbindung der Schieberteile
verwendeten Gewebe und Klebstoffe, endlich auch die verwendeten
Lacke ständig Ausströmungen von reduzierender
Wirkung von sich geben, die auf die lichtempfindliche Schicht
verschleiernd wirken; man darf daher in solchen Kassetten
die Platten nie längere Zeit (über eine Woche)
liegen lassen, ohne mit deren Verderben rechnen zu müssen.
Wegen dieses Fehlers hat man bei Klappkameras schon bald
die Holzkassetten durch Ebonitkassetten oder wenigstens
die Holzschieber durch Ebonit- oder Aluminiumschieber
ersetzt; nun zeigte aber Ebonit elektrische Entladungserscheinungen
und keine absolute Lichtdichtigkeit, Aluminium radioaktive
und oxydative Beeinflussungen der Schicht. Eisenblech, Messing
und Nickel sind jetzt als die zweckmäßigsten
Materialien für Kassetten erkannt, und wenn schon nicht
die ganze Kassette, so soll zumindest der Schieber daraus
bestehen. Die Doppelkassette mußte dabei immer mehr
und mehr der Einzelkassette weichen, und die Einzelkassette
aus Eisenblech stellt gegenwärtig absolut
den preiswertesten und zweckmäßigsten Plattenbehälter
für Formate unter 13 x 18 cm dar; an die Kamera angeschoben
vergrößert sie deren Volumen nicht im geringsten
und macht sie erhöht schußbereit.
Bei
Stativapparaten werden vorwiegend Holzkassetten mit
jalousieartig zusammengesetzten Holzschiebern verwendet.
Solchen Schiebern haftet der prinzipielle übelstand
an, daß Holz, die zur Verbindung der Schieberteile
verwendeten Gewebe und Klebstoffe, endlich auch die verwendeten
Lacke ständig Ausströmungen von reduzierender
Wirkung von sich geben, die auf die lichtempfindliche Schicht
verschleiernd wirken; man darf daher in solchen Kassetten
die Platten nie längere Zeit (über eine Woche)
liegen lassen, ohne mit deren Verderben rechnen zu müssen.
Wegen dieses Fehlers hat man bei Klappkameras schon bald
die Holzkassetten durch Ebonitkassetten oder wenigstens
die Holzschieber durch Ebonit- oder Aluminiumschieber
ersetzt; nun zeigte aber Ebonit elektrische Entladungserscheinungen
und keine absolute Lichtdichtigkeit, Aluminium radioaktive
und oxydative Beeinflussungen der Schicht. Eisenblech, Messing
und Nickel sind jetzt als die zweckmäßigsten
Materialien für Kassetten erkannt, und wenn schon nicht
die ganze Kassette, so soll zumindest der Schieber daraus
bestehen. Die Doppelkassette mußte dabei immer mehr
und mehr der Einzelkassette weichen, und die Einzelkassette
aus Eisenblech stellt gegenwärtig absolut
den preiswertesten und zweckmäßigsten Plattenbehälter
für Formate unter 13 x 18 cm dar; an die Kamera angeschoben
vergrößert sie deren Volumen nicht im geringsten
und macht sie erhöht schußbereit.
Seite 46
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
 Hat
man unter Holzkassetten zu wählen, so sind Buchkassetten
vorzuziehen; sie sind zwar etwas dicker und teurer als nicht
aufklappbare, aber die Platte liegt darin sicherer und fester.
Hat
man unter Holzkassetten zu wählen, so sind Buchkassetten
vorzuziehen; sie sind zwar etwas dicker und teurer als nicht
aufklappbare, aber die Platte liegt darin sicherer und fester.
 Zum
Einlegen von Flachfilms (S.
58) in nicht aufklappbare Kassetten verwendet
man besondere Filmrähmchen (Fig.94) aus Pappe oder
Blech, in die man die Films, zwischen Wand und Rahmen geklemmt,
einlegt.
Zum
Einlegen von Flachfilms (S.
58) in nicht aufklappbare Kassetten verwendet
man besondere Filmrähmchen (Fig.94) aus Pappe oder
Blech, in die man die Films, zwischen Wand und Rahmen geklemmt,
einlegt.

 Um
Platten kleineren Formats in größeren Kassetten
verwenden zu können, verwendet man kleine Einlegerahmen
(Fig.95), die zusammen mit der Platte in die Kassette gelegt
werden. Die mit festen Ecken (a) sind vorzuziehen, die mit
Vorreibern versehenen sind oft Anlaß zu Mißerfolgen.
Um
Platten kleineren Formats in größeren Kassetten
verwenden zu können, verwendet man kleine Einlegerahmen
(Fig.95), die zusammen mit der Platte in die Kassette gelegt
werden. Die mit festen Ecken (a) sind vorzuziehen, die mit
Vorreibern versehenen sind oft Anlaß zu Mißerfolgen.
 Statt
einfacher und Doppelkassetten kann man sich auch sog. Magazinwechselkassetten
bedienen. Bei diesen befindet sich eine Kassette zugleich
mit einem Vorratsraum für eine gewisse Anzahl von Platten
in Verbindung. Solche Wechselkassette wird bei den gewöhnlichen
Kameras einfach an Stelle der üblichen einfachen Kassette
eingeschoben.
Statt
einfacher und Doppelkassetten kann man sich auch sog. Magazinwechselkassetten
bedienen. Bei diesen befindet sich eine Kassette zugleich
mit einem Vorratsraum für eine gewisse Anzahl von Platten
in Verbindung. Solche Wechselkassette wird bei den gewöhnlichen
Kameras einfach an Stelle der üblichen einfachen Kassette
eingeschoben.
 |
.  Derartige
Vorrichtungen sind für Reisen manchmal angenehm,
teilen freilich den Fehler der Magazinkamera (S.
39), daß darin die Platten leicht verstauben
und dadurch die Bilder voll kleiner Punkte werden. In
solche Magazinkassetten werden die Platten vermittels
Metallrähmchen eingelegt, und zwar so, daß
die Schichtseite dem Kassettenschieber zugewendet ist. Derartige
Vorrichtungen sind für Reisen manchmal angenehm,
teilen freilich den Fehler der Magazinkamera (S.
39), daß darin die Platten leicht verstauben
und dadurch die Bilder voll kleiner Punkte werden. In
solche Magazinkassetten werden die Platten vermittels
Metallrähmchen eingelegt, und zwar so, daß
die Schichtseite dem Kassettenschieber zugewendet ist. |
 Die
modernen Wechselkassetten bestehen aus zwei ineinanderschiebbaren
Kästen; das Wechseln der Platten (bis zu 12 Stück)
wird einfach durch Ausziehen und Wiedereinschieben des inneren
Kastens (siehe Fig.96) bewirkt. Für größere
Formate (über 9 x 12 bis 13 x 18) werden die Wechselkassetten
oft nicht aus zwei Kästen, sondern mit einem ledernen
Wechselsack (Fig.97) ausgeführt; damit geht aber das
Wechseln langsamer vor sich.
Die
modernen Wechselkassetten bestehen aus zwei ineinanderschiebbaren
Kästen; das Wechseln der Platten (bis zu 12 Stück)
wird einfach durch Ausziehen und Wiedereinschieben des inneren
Kastens (siehe Fig.96) bewirkt. Für größere
Formate (über 9 x 12 bis 13 x 18) werden die Wechselkassetten
oft nicht aus zwei Kästen, sondern mit einem ledernen
Wechselsack (Fig.97) ausgeführt; damit geht aber das
Wechseln langsamer vor sich.
 Wechselkassetten
können auch für Planfilms benutzt werden, wenn
diese in besondere Rähmchen gelegt werden.
Wechselkassetten
können auch für Planfilms benutzt werden, wenn
diese in besondere Rähmchen gelegt werden.
 Flachfilms
werden gegenwärtig aber nur noch selten in solchen
Wechselkassetten verwendet, man zieht die modernen Filmpacks
(siehe S.
58) vor, die für sich eine besondere Kassette
beanspruchen; diese kann aber jeder beliebigen Kamera für
Platten angepaßt werden.
Flachfilms
werden gegenwärtig aber nur noch selten in solchen
Wechselkassetten verwendet, man zieht die modernen Filmpacks
(siehe S.
58) vor, die für sich eine besondere Kassette
beanspruchen; diese kann aber jeder beliebigen Kamera für
Platten angepaßt werden.
Seite 47
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
 In
ähnlicher Weise wie in Filmkameras (siehe S.
46) können Rollfilms (siehe S.
59) auch in Rollfilmkassetten verwendet werden,
die dann an jede Kamera angesetzt werden können und
diese zur Rollfilmkamera machen.
In
ähnlicher Weise wie in Filmkameras (siehe S.
46) können Rollfilms (siehe S.
59) auch in Rollfilmkassetten verwendet werden,
die dann an jede Kamera angesetzt werden können und
diese zur Rollfilmkamera machen.
 Das
Einlegen der Rollfilms in diese Rollkassetten hat in etwas
anderer Weise zu geschehen, als bei den Rollkameras, da
bei den Kameras die Spulen seitlich neben der zu belichtenden
Filmfläche liegen, während sie bei den Kassetten
hinter ihr befinden. Im ersten Fall läuft der Filmstreifen
einfach von Spule zu Spule und wird nur durch die Spannung
straff gehalten. Bei den Rollkassetten bedarf die zu belichtende
Filmfläche jedoch einer besonderen Stütze durch
eine hinter ihm angeordnete Holzplatte, über die der
Film hinweggezogen wird.
Das
Einlegen der Rollfilms in diese Rollkassetten hat in etwas
anderer Weise zu geschehen, als bei den Rollkameras, da
bei den Kameras die Spulen seitlich neben der zu belichtenden
Filmfläche liegen, während sie bei den Kassetten
hinter ihr befinden. Im ersten Fall läuft der Filmstreifen
einfach von Spule zu Spule und wird nur durch die Spannung
straff gehalten. Bei den Rollkassetten bedarf die zu belichtende
Filmfläche jedoch einer besonderen Stütze durch
eine hinter ihm angeordnete Holzplatte, über die der
Film hinweggezogen wird.

 Der
Film kann daher nicht direkt, dem Lauf seiner Wicklung entsprechend,
nach der Aufwindespule hinübergeführt werden,
wie bei den Kameras, sondern es ist noch eine zweite Windung
nach vorn um das Stützbrett herum erforderlich, damit
die Schichtseite des Films nach vorn, dem Objektiv zugewendet,
zu liegen kommt, die andernfalls von der Holzplatte verdeckt
werden würde (vgl. Bild 99).
Der
Film kann daher nicht direkt, dem Lauf seiner Wicklung entsprechend,
nach der Aufwindespule hinübergeführt werden,
wie bei den Kameras, sondern es ist noch eine zweite Windung
nach vorn um das Stützbrett herum erforderlich, damit
die Schichtseite des Films nach vorn, dem Objektiv zugewendet,
zu liegen kommt, die andernfalls von der Holzplatte verdeckt
werden würde (vgl. Bild 99).
 Die
älteren Kassetten dieser Art erforderten Rollfilm von
besonderer Wicklung, waren daher praktisch wertlos; die
neueren verwenden die üblichen Rollfilm. Zu beachten
ist, daß die Rollfilmkassette eine andere Mattscheibenstellung
oder Einstellskala verlangt als Platten, da der Film weiter
vom Objektiv entfernt liegt.
Die
älteren Kassetten dieser Art erforderten Rollfilm von
besonderer Wicklung, waren daher praktisch wertlos; die
neueren verwenden die üblichen Rollfilm. Zu beachten
ist, daß die Rollfilmkassette eine andere Mattscheibenstellung
oder Einstellskala verlangt als Platten, da der Film weiter
vom Objektiv entfernt liegt.
Seite 48
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
VII. Das Stativ
 Bei
allen Zeitaufnahmen, also Aufnahmen über ½ Sekunde
höchstens, ist es nötig, dem Apparat eine feste
Unterlage zu geben. Falls hierzu nicht ein Tisch, Kasten,
die Lehnen zweier zusammengeschobener Stühle, ein Felsen,
Zaun usw. zur Verfügung stehen, muß man ein Stativ
verwenden, das entweder, für Außenaufnahmen,
zusammenklappbarer oder, für Atelieraufnahmen, fest
ist.
Bei
allen Zeitaufnahmen, also Aufnahmen über ½ Sekunde
höchstens, ist es nötig, dem Apparat eine feste
Unterlage zu geben. Falls hierzu nicht ein Tisch, Kasten,
die Lehnen zweier zusammengeschobener Stühle, ein Felsen,
Zaun usw. zur Verfügung stehen, muß man ein Stativ
verwenden, das entweder, für Außenaufnahmen,
zusammenklappbarer oder, für Atelieraufnahmen, fest
ist.
 Sie besitzen drei zusammenklappbare
Beine, die in zweierlei Weise mit dem oberen Teil, dem Stativkopf,
verbunden sein können: er ist entweder abnehmbar, die
oberen Spreizen der Stativbeine werden durch ihre Federkraft
in Zapfen des dreieckigen Kopfteils ("Stativdreieck")
festgehalten (Bild 100), zum Verpacken wird jedes der untersten
Stativglieder in das mittlere umgeklappt und eingelegt;
die oberen Streben sind seitlich auf das Mittelteil umklappbar.
- In Fig.101 hingegen finden wir ein Stativ mit nicht abnehmbarem
Kopf; hier sind, nachdem die Feststellungen gelöst
sind, die einzelnen Teile ineinanderschiebbar. Diese Stative
müssen aus besonders geeignetem Holze gearbeitet sein,
andernfalls die Stäbe bei feuchtem Wetter leicht quellen
und das Arbeiten unmöglich machen.
Sie besitzen drei zusammenklappbare
Beine, die in zweierlei Weise mit dem oberen Teil, dem Stativkopf,
verbunden sein können: er ist entweder abnehmbar, die
oberen Spreizen der Stativbeine werden durch ihre Federkraft
in Zapfen des dreieckigen Kopfteils ("Stativdreieck")
festgehalten (Bild 100), zum Verpacken wird jedes der untersten
Stativglieder in das mittlere umgeklappt und eingelegt;
die oberen Streben sind seitlich auf das Mittelteil umklappbar.
- In Fig.101 hingegen finden wir ein Stativ mit nicht abnehmbarem
Kopf; hier sind, nachdem die Feststellungen gelöst
sind, die einzelnen Teile ineinanderschiebbar. Diese Stative
müssen aus besonders geeignetem Holze gearbeitet sein,
andernfalls die Stäbe bei feuchtem Wetter leicht quellen
und das Arbeiten unmöglich machen.

 Von
Vorteil ist die neuere Konstruktion der Schnappstative,
bei denen nur das unterste Glied jedes Beines in dem mittleren
verschiebbar ist, die Mittelglieder hingegen in das obere
Glied umgelegt und beim Herausklappen durch eine Schnappvorrichtung
(Bild 102) in ihrer Stellung erhalten werden. Mehr als drei
Stativbeinglieder sind nicht von Vorteil.
Von
Vorteil ist die neuere Konstruktion der Schnappstative,
bei denen nur das unterste Glied jedes Beines in dem mittleren
verschiebbar ist, die Mittelglieder hingegen in das obere
Glied umgelegt und beim Herausklappen durch eine Schnappvorrichtung
(Bild 102) in ihrer Stellung erhalten werden. Mehr als drei
Stativbeinglieder sind nicht von Vorteil.
 Will
man den Landschaftsapparat auch für Aufnahmen im Zimmer
oder auf glatten Boden gebrauchen, so versieht man das Stativ
vorteilhaft mit einem sog. Stativfeststeller (Bild
103), d.i. ein Metallgestänge, durch das die Füße
des Stativs in verschiedener Weitenstellung fest miteinander
verbunden werden können, so daß ein Ausrutschen
nicht möglich ist. In Ermangelung eines solchen Feststellers
verbinde man die Füße des Stativs durch eine
Schnur. - Eine andere Abhilfe gegen das Ausrutschen besteht
darin, daß unter die Füße flache Kork-
oder Gummischeiben gelegt werden.
Will
man den Landschaftsapparat auch für Aufnahmen im Zimmer
oder auf glatten Boden gebrauchen, so versieht man das Stativ
vorteilhaft mit einem sog. Stativfeststeller (Bild
103), d.i. ein Metallgestänge, durch das die Füße
des Stativs in verschiedener Weitenstellung fest miteinander
verbunden werden können, so daß ein Ausrutschen
nicht möglich ist. In Ermangelung eines solchen Feststellers
verbinde man die Füße des Stativs durch eine
Schnur. - Eine andere Abhilfe gegen das Ausrutschen besteht
darin, daß unter die Füße flache Kork-
oder Gummischeiben gelegt werden.
Seite 49
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis
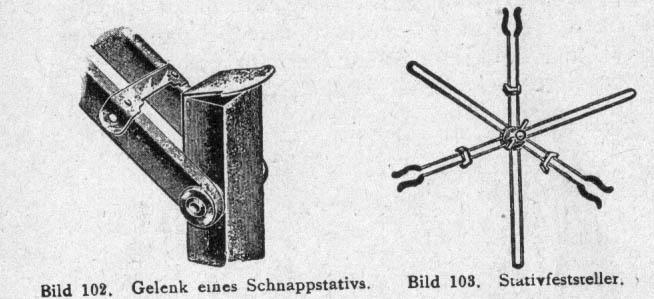
Leichter an
Gewicht und von geringerem Volumen als die Holzstative sind
die Röhrenstative (Bild 104).
 |
 Die
Füße bestehen hier aus ineinanderschiebbaren
Messingröhren, meist mehr als dreigliedrig. Sie
werden neuerdings vielfach mit Flachkopf, teilweise
neigbar ausgestattet, wodurch eine bequemere Zusammenlegbarkeit
gewährleistet ist. Unpraktisch sind solche Röhrenstative
aus Aluminium, die der leisesten Erschütterung,
jedem Windstoß preisgegeben sind. Metallröhrenstative
eignen sich nur für Apparate bis zu 10 x 15 cm. Die
Füße bestehen hier aus ineinanderschiebbaren
Messingröhren, meist mehr als dreigliedrig. Sie
werden neuerdings vielfach mit Flachkopf, teilweise
neigbar ausgestattet, wodurch eine bequemere Zusammenlegbarkeit
gewährleistet ist. Unpraktisch sind solche Röhrenstative
aus Aluminium, die der leisesten Erschütterung,
jedem Windstoß preisgegeben sind. Metallröhrenstative
eignen sich nur für Apparate bis zu 10 x 15 cm.
 Für
gewisse Zwecke empfiehlt sich die Anbringung eines Kugelgelenkes
(siehe Bild
105) zwischen Stativdreieck und Kamera. Man
kann mittels desselben die Kamera in beinahe jeder beliebigen
Richtung feststellen, was für Wolkenaufnahmen,
Deckenaufnahmen, Aufnahmen für medizinische Zwecke
usw. oft von großem Vorteil ist. Für
gewisse Zwecke empfiehlt sich die Anbringung eines Kugelgelenkes
(siehe Bild
105) zwischen Stativdreieck und Kamera. Man
kann mittels desselben die Kamera in beinahe jeder beliebigen
Richtung feststellen, was für Wolkenaufnahmen,
Deckenaufnahmen, Aufnahmen für medizinische Zwecke
usw. oft von großem Vorteil ist.
 Bedeutend
verläßlicher und fester sind die etwas umfangreicheren
Kameraneiger aus Metall (Messing oder Magnalium)
nach Art des in Bild
106 dargestellten; sie sind entweder fest
mit dem Stativkopf verbunden oder (besser) getrennt. Bedeutend
verläßlicher und fester sind die etwas umfangreicheren
Kameraneiger aus Metall (Messing oder Magnalium)
nach Art des in Bild
106 dargestellten; sie sind entweder fest
mit dem Stativkopf verbunden oder (besser) getrennt.
|
Seite 50
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis
zum
Stichwortverzeichnis weiter
weiter