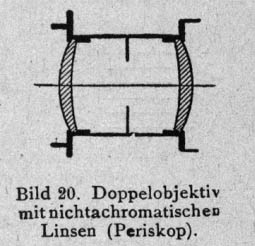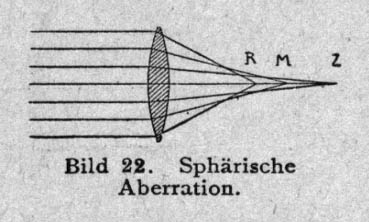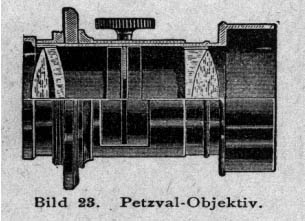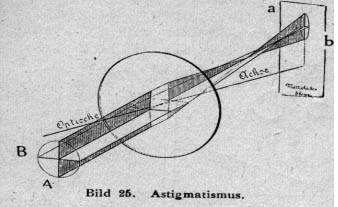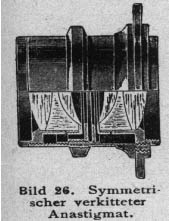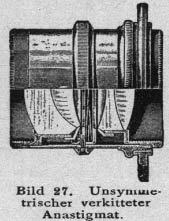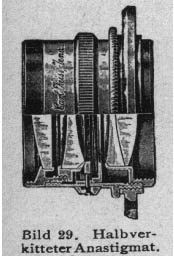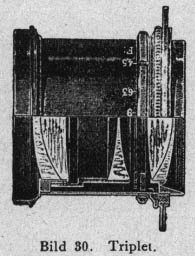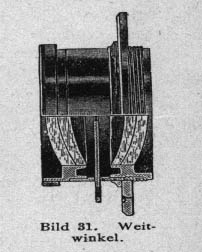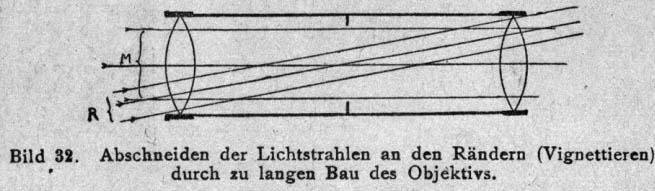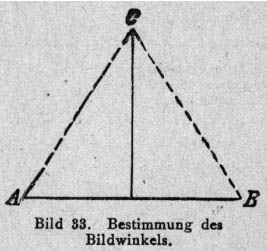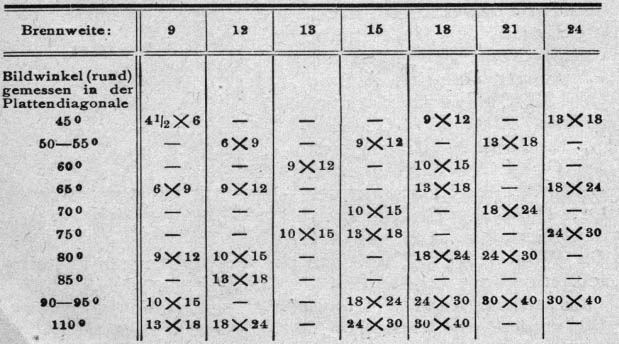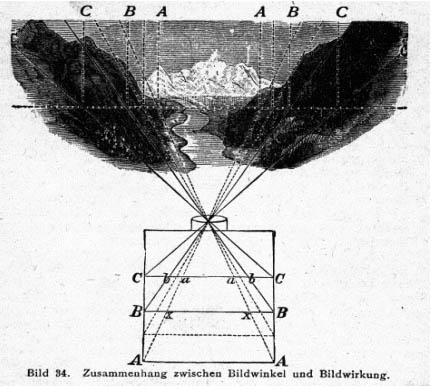|
 Die
Verzeichnung der Randlinien tritt natürlich
auch bei nichtachromatischen einfachen Linsen
(Monokel, S.
9) auf. Die
Verzeichnung der Randlinien tritt natürlich
auch bei nichtachromatischen einfachen Linsen
(Monokel, S.
9) auf.
 Vereinigt
man zwei gleiche einfache Linsen so miteinander,
dass sie einander in einiger Entfernung
gegenüberstehen (z.B. zwei Linsen von
je 24 cm Brennweite in einem Abstande von
5 cm) und bringt die Blende in der Mitte
zwischen beiden an (Bild 20), so hebt sich
die Verkrümmung durch die Vorderlinse
und durch die Hinterlinse gegenseitig auf,
und wir erhalten mit einem solchen Doppelobjektiv
verzeichnungsfreie Bilder. Vereinigt
man zwei gleiche einfache Linsen so miteinander,
dass sie einander in einiger Entfernung
gegenüberstehen (z.B. zwei Linsen von
je 24 cm Brennweite in einem Abstande von
5 cm) und bringt die Blende in der Mitte
zwischen beiden an (Bild 20), so hebt sich
die Verkrümmung durch die Vorderlinse
und durch die Hinterlinse gegenseitig auf,
und wir erhalten mit einem solchen Doppelobjektiv
verzeichnungsfreie Bilder.
 Wir
können dabei einfache (nicht achromatische)
Linsen verwenden und erhalten damit ein
Periskop (Bild 20), das eine Fokusdifferenz
aufweist (vgl. S.
10), oder wir verwenden zwei
achromatische Landschaftslinsen und erhalten
damit einem Aplanaten (Bild 21);
die größte verwendbare öffnung
bei Periskopen beträgt F:11 bis F:13,
bei Aplanaten durchschnittlich F:6 bis F:8,
in einzelnen Fällen und für gewisse
Zwecke (Bildnisse) bis zu F:5. Wir
können dabei einfache (nicht achromatische)
Linsen verwenden und erhalten damit ein
Periskop (Bild 20), das eine Fokusdifferenz
aufweist (vgl. S.
10), oder wir verwenden zwei
achromatische Landschaftslinsen und erhalten
damit einem Aplanaten (Bild 21);
die größte verwendbare öffnung
bei Periskopen beträgt F:11 bis F:13,
bei Aplanaten durchschnittlich F:6 bis F:8,
in einzelnen Fällen und für gewisse
Zwecke (Bildnisse) bis zu F:5.
 Weitere
Fehler der einfachen Linsen sind; die sphärische
Aberration: die vom Rande der Linse
kommenden Strahlen werden stärker gebrochen
als die von der Mitte kommenden (Zentralstrahlen);
dies hat zur Folge, dass das Bild nirgends
ganz scharf wird, außer wenn wir stärker
abblenden. Das Abblenden bringt aber wiederum
die Erscheinung der Blendendifferenz
mit sich: stellen wir bei größerer
öffnung scharf ein, so geschieht dies
auf einen Punkt M zwischen R und Z (Bild
22); schneiden wir nun durch eine Blende
die Randstrahlen ab, so liegt die größte
Schärfe nicht mehr zwischen R und Z,
sondern bei Z; wir müssen also bei
solchen Linsen mit sphärischer Abweichung
(einfache Linsen, Landschaftslinsen und
mindere Aplanate) immer mit der Blende einstellen,
mit der wir aufnehmen wollen. Weitere
Fehler der einfachen Linsen sind; die sphärische
Aberration: die vom Rande der Linse
kommenden Strahlen werden stärker gebrochen
als die von der Mitte kommenden (Zentralstrahlen);
dies hat zur Folge, dass das Bild nirgends
ganz scharf wird, außer wenn wir stärker
abblenden. Das Abblenden bringt aber wiederum
die Erscheinung der Blendendifferenz
mit sich: stellen wir bei größerer
öffnung scharf ein, so geschieht dies
auf einen Punkt M zwischen R und Z (Bild
22); schneiden wir nun durch eine Blende
die Randstrahlen ab, so liegt die größte
Schärfe nicht mehr zwischen R und Z,
sondern bei Z; wir müssen also bei
solchen Linsen mit sphärischer Abweichung
(einfache Linsen, Landschaftslinsen und
mindere Aplanate) immer mit der Blende einstellen,
mit der wir aufnehmen wollen.
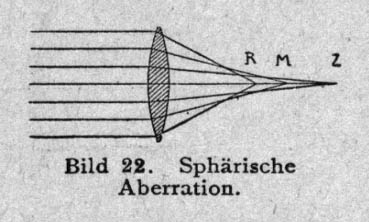 |
 Die
sphärische Abweichung tritt
bei schief auffallenden Strahlen
noch in einer besonderen Form als
Koma auf, die sich darin äußert,
dass z.B. helle Punkte gegen den
Rand zu einseitig kometenschweifartig
verzerrt sind. Sphärische Abweichung
und Koma sind bei Aplanaten meist
hinreichend, völlig nur bei
Anastigmaten beseitigt. |
Seite 11
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis zum
Stichwortverzeichnis
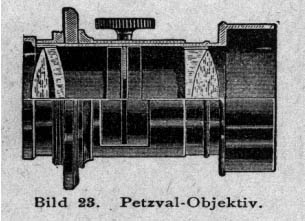 |
 Als
aplanatische Doppelobjektive unsymmetrischen
Baues sind die alten Porträtobjektive
nach der Konstruktion Petzvals (siehe
Bild 23) zu nennen; sie bestehen
aus einer verkitteten Vorderlinse
und einem hinteren Linsenpaar, dieses
unverkittet, durch Luftschicht getrennt.
Solche Objektive, die lediglich
für den Gebrauch im Atelier
und für Projektion bestimmt
sind, werden auch in neuer Zeit
unter dem Namen "Porträtobjektive"
von verschiedenen Firmen in ähnlicher
Konstruktion hergestellt; die öffnung
dieser Instrumente geht bis zu F:2,3.
Das brauchbare Bildfeld ist sehr
klein, die große Lichtstärke
und damit zusammenhängende
geringe Schärfentiefe macht
das Petzval-Objektiv aber gerade
für Bildnisaufnahmen recht
geeignet, da sich die scharf eingestellten
Teile des Gesichts um so plastischer
von den unscharf gebliebenen hinteren
Teilen des Kopfes und vom Hintergrunde
abheben.
|
|
Die Fehler des
Doppelobjektivs und ihre Behebung |
 Sind
beim Aplanaten die chromatische Abweichung
und die Distorsion beseitig, so bleibt ihm
noch eine Reihe weiterer Fehler, die sich
beim Arbeiten mit größeren Blenden
lästig zeigen; es sind dies die
Bildfeldwölbung und der Astigmatismus. Sind
beim Aplanaten die chromatische Abweichung
und die Distorsion beseitig, so bleibt ihm
noch eine Reihe weiterer Fehler, die sich
beim Arbeiten mit größeren Blenden
lästig zeigen; es sind dies die
Bildfeldwölbung und der Astigmatismus.
 Die
Bildfeldwölbung zeigt sich darin, dass
das Bild eines ebenen Gegenstandes nicht
in einer Ebene, sondern auf einer Kugelschale
entworfen wird (vgl. Bild 24 bei a), so
dass man auf der Mattscheibe immer nur entweder
die Mitte (bei b) oder den Rand (bei
a) scharf erhalten kann (Bild 24). Die
Bildfeldwölbung zeigt sich darin, dass
das Bild eines ebenen Gegenstandes nicht
in einer Ebene, sondern auf einer Kugelschale
entworfen wird (vgl. Bild 24 bei a), so
dass man auf der Mattscheibe immer nur entweder
die Mitte (bei b) oder den Rand (bei
a) scharf erhalten kann (Bild 24).
 Der
Astigmatismus ferner erhöht diesen
Fehler noch dadurch, dass schief einfallende
Lichtstrahlen, die z.B. in der senkrechten
Ebene A liegen (Bild 25), in dem Punkte
a, die in der wagrechten Ebene B liegenden
in dem Punkte b vereinigt werden; die ersten
werden daher auf der Bildfläche a (Bild
25) vereinigt, die zweiten auf der Fläche
b, und zwar jedes mal nicht zu einem Punkte,
sondern günstigen falls bei a zu einer
wagrechten Linie, bei b zu einer darauf
senkrechten. Ein Liniennetz wird daher von
einer gewissen Einstellung mit scharfen
senkrechten aber unscharfen waagrechten,
bei einer anderen Einstellung mit scharfen
wagrechten und unscharfen senkrechten Linien
dargestellt. Der
Astigmatismus ferner erhöht diesen
Fehler noch dadurch, dass schief einfallende
Lichtstrahlen, die z.B. in der senkrechten
Ebene A liegen (Bild 25), in dem Punkte
a, die in der wagrechten Ebene B liegenden
in dem Punkte b vereinigt werden; die ersten
werden daher auf der Bildfläche a (Bild
25) vereinigt, die zweiten auf der Fläche
b, und zwar jedes mal nicht zu einem Punkte,
sondern günstigen falls bei a zu einer
wagrechten Linie, bei b zu einer darauf
senkrechten. Ein Liniennetz wird daher von
einer gewissen Einstellung mit scharfen
senkrechten aber unscharfen waagrechten,
bei einer anderen Einstellung mit scharfen
wagrechten und unscharfen senkrechten Linien
dargestellt.
 Beide
Fehler sind mehr oder weniger gut bei den
Anastigmaten behoben, Doppelobjektiven,
die meist mehr als 4 Linsen besitzen; hiervon
können einzelne als Luftlinsen bestehen,
d.h. dargestellt sein durch den freien Luftraum
zwischen zwei, nicht miteinander verbundenen
(verkitteten) Linsen (wie bei
Bild 28). Beide
Fehler sind mehr oder weniger gut bei den
Anastigmaten behoben, Doppelobjektiven,
die meist mehr als 4 Linsen besitzen; hiervon
können einzelne als Luftlinsen bestehen,
d.h. dargestellt sein durch den freien Luftraum
zwischen zwei, nicht miteinander verbundenen
(verkitteten) Linsen (wie bei
Bild 28).
 Man
hat zu unterscheiden zwischen symmetrischen
(Bild
26) und unsymmetrischen (Bild
27 und 29)
Anastigmaten; bei den symmetrischen
sind vordere und hintere Objektivhälfte
ganz gleich, bei den unsymmetrischen sind
sie verschieden. Ferner ist zu unterscheiden
zwischen verkitteten(Bild 26 und 27), unverkitteten
(Bild 28) und halbverkitteten (Bild 29).
Zu den unsymmetrischen, und zwar als halbverkittete,
gehören auch die Triplets (Bild 30).
Die verkitteten haben nur Glaslinsen, mindestens
4, meist 6, oft auch 8 oder mehr, die anderen
noch je 2 (Bild 28) oder 1 Luftlinse (Bild
29). Eine allgemeine Regel, dass einer dieser
Typen besser sei als der andere, lässt
sich nicht aufstellen, jeder, richtig konstruiert,
kann beste Leistungsfähigkeit in jeder
Richtung zeigen. Man
hat zu unterscheiden zwischen symmetrischen
(Bild
26) und unsymmetrischen (Bild
27 und 29)
Anastigmaten; bei den symmetrischen
sind vordere und hintere Objektivhälfte
ganz gleich, bei den unsymmetrischen sind
sie verschieden. Ferner ist zu unterscheiden
zwischen verkitteten(Bild 26 und 27), unverkitteten
(Bild 28) und halbverkitteten (Bild 29).
Zu den unsymmetrischen, und zwar als halbverkittete,
gehören auch die Triplets (Bild 30).
Die verkitteten haben nur Glaslinsen, mindestens
4, meist 6, oft auch 8 oder mehr, die anderen
noch je 2 (Bild 28) oder 1 Luftlinse (Bild
29). Eine allgemeine Regel, dass einer dieser
Typen besser sei als der andere, lässt
sich nicht aufstellen, jeder, richtig konstruiert,
kann beste Leistungsfähigkeit in jeder
Richtung zeigen.
*Anfänger
mögen zunächst die kleiner gedruckten
Teile des Textes überspringen.
Seite 12
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis zum
Stichwortverzeichnis
 Jedes
Objektiv gibt nur über eine gewisse
Fläche ein Bild, darüber hinaus
lässt es die Mattscheibe finster (vgl.
Bild
11); zu diesem Versuch muss man
das Objektiv in einen größeren
Apparat einsetzen, als für den es bestimmt
ist, z.B. ein für 9x12 - Aufnahmen
bestimmtes in einen Apparat für mindestens
13x18 cm. Dieses volle Bildfeld (Gesichtsfeld)
können wir nicht ausnützen, sondern
nur, entsprechend der rechteckigen Form
unserer Platten, einen Ausschnitt davon,
das nutzbare Bildfeld; es darf mit
seinen Ecken nicht bis dicht an den Rand
des Gesichtsfeldes reichen, denn hier ist
die Helligkeit und die Schärfe in der
Regel geringer als in der Mitte, und wir
würden daher im Bilde dunklere und
unscharfe Ecken erhalten; wir könnten
ferner das Objektiv nicht, wie es oft nötig
ist (vgl. S.
77), verschieben, ohne dunkle
Ecken ins Bild zu bekommen. Durch Abblenden
(vgl. S.
21) wird das Gesichtsfeld nicht
vergrößert, wohl aber kann das
brauchbare Bildfeld etwas vergrößert
werden, indem die Schärfe und gleichmäßige
Helligkeit bis weiter an den Rand herangebracht
wird. Das brauchbare Bildfeld oder gar das
Gesichtsfeld können durch unzweckmäßigen
Bau der Objektivfassung unnötig eingeschränkt
sein, indem die zu lange Fassung oder ihr
Vorbau die Strahlen von den Rändern
abschneidet (Bild 32); der Durchmesser des
die Mitte der Platte treffenden Strahlenbündels
M ist bedeutend größer als der
des Bündels R, das die Ränder
der Platte erreicht. Von einem solchen Objektiv
sagt man, dass es vignettiert; durch
Abblenden wird das Vignettieren vermindert. Jedes
Objektiv gibt nur über eine gewisse
Fläche ein Bild, darüber hinaus
lässt es die Mattscheibe finster (vgl.
Bild
11); zu diesem Versuch muss man
das Objektiv in einen größeren
Apparat einsetzen, als für den es bestimmt
ist, z.B. ein für 9x12 - Aufnahmen
bestimmtes in einen Apparat für mindestens
13x18 cm. Dieses volle Bildfeld (Gesichtsfeld)
können wir nicht ausnützen, sondern
nur, entsprechend der rechteckigen Form
unserer Platten, einen Ausschnitt davon,
das nutzbare Bildfeld; es darf mit
seinen Ecken nicht bis dicht an den Rand
des Gesichtsfeldes reichen, denn hier ist
die Helligkeit und die Schärfe in der
Regel geringer als in der Mitte, und wir
würden daher im Bilde dunklere und
unscharfe Ecken erhalten; wir könnten
ferner das Objektiv nicht, wie es oft nötig
ist (vgl. S.
77), verschieben, ohne dunkle
Ecken ins Bild zu bekommen. Durch Abblenden
(vgl. S.
21) wird das Gesichtsfeld nicht
vergrößert, wohl aber kann das
brauchbare Bildfeld etwas vergrößert
werden, indem die Schärfe und gleichmäßige
Helligkeit bis weiter an den Rand herangebracht
wird. Das brauchbare Bildfeld oder gar das
Gesichtsfeld können durch unzweckmäßigen
Bau der Objektivfassung unnötig eingeschränkt
sein, indem die zu lange Fassung oder ihr
Vorbau die Strahlen von den Rändern
abschneidet (Bild 32); der Durchmesser des
die Mitte der Platte treffenden Strahlenbündels
M ist bedeutend größer als der
des Bündels R, das die Ränder
der Platte erreicht. Von einem solchen Objektiv
sagt man, dass es vignettiert; durch
Abblenden wird das Vignettieren vermindert.
Seite 13
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis zum
Stichwortverzeichnis
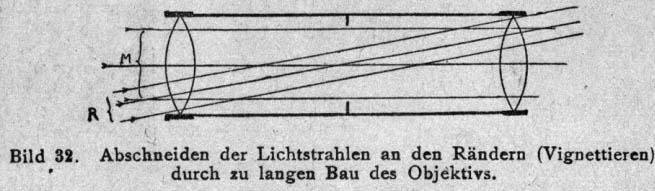
 Nachfolgende
Tabelle zeigt uns an, welchen Durchmesser
das brauchbare (scharfe, gleichmäßig
beleuchtete) Bildfeld für den üblichen
Plattenformate haben muss: Nachfolgende
Tabelle zeigt uns an, welchen Durchmesser
das brauchbare (scharfe, gleichmäßig
beleuchtete) Bildfeld für den üblichen
Plattenformate haben muss:
| |
|
Erforderliche DurchmesserDes
brauchbaren Bildfeldes |
| Plattengröße |
6
x 9 cm |
11
cm |
| Plattengröße |
9
x 12 cm |
15
cm |
| Plattengröße |
10
x 15 cm |
18
cm |
| Plattengröße |
13
x 18 cm |
23
cm |
| Plattengröße |
18
x 24 cm |
30
cm |
| Plattengröße |
24
x 30 cm |
38
cm |
| Plattengröße |
30
x 40 cm |
50
cm |
 Hierbei
ist natürlich vorausgesetzt, dass die
Objektivachse genau auf die Mitte der Platte
gerichtet ist. Wenn, wie dies häufig
bei Landschafts- und Gebäudeaufnahmen
geschieht, das Objektiv nach oben oder unten
verschoben wird, so kommt es vor, dass die
Ecken der Platte außerhalb des Bildfeldes
zu liegen kommen und infolgedessen nicht
mitbelichtet werden. Will man also in der
Begrenzung des Bildes mehr Spielraum haben,
so muss ein Objektiv mit größerem
Bildfelddurchmesser genommen werden. Hierbei
ist natürlich vorausgesetzt, dass die
Objektivachse genau auf die Mitte der Platte
gerichtet ist. Wenn, wie dies häufig
bei Landschafts- und Gebäudeaufnahmen
geschieht, das Objektiv nach oben oder unten
verschoben wird, so kommt es vor, dass die
Ecken der Platte außerhalb des Bildfeldes
zu liegen kommen und infolgedessen nicht
mitbelichtet werden. Will man also in der
Begrenzung des Bildes mehr Spielraum haben,
so muss ein Objektiv mit größerem
Bildfelddurchmesser genommen werden.
 Die
Ausdehnung des Bildfeldes und damit das
verwendbare Plattenformat stehen in einem
bestimmten wichtigen Verhältnis zur
Brennweite des Objektives. Die
Ausdehnung des Bildfeldes und damit das
verwendbare Plattenformat stehen in einem
bestimmten wichtigen Verhältnis zur
Brennweite des Objektives.
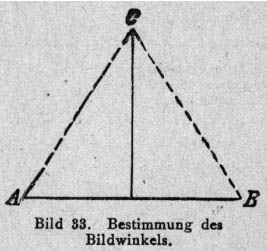 |
 Denkt
man sich die Endpunkte des Bildfelddurchmesser
mit dem optischen Mittelpunkt (hinteren
Hauptpunkt, vgl. S.
5) des Objektivs verbunden,
so schließen die Verbindungslinien
einen Winkel ein, den man als den
Bildwinkel bezeichnet. Dieser wird
bestimmt, indem man auf einen weit
entfernten Gegenstand einstellt
und den Bildfelddurchmesser auf
der Mattscheibe misst; dieser sei
gleich der Länge der Geraden
A B in Bild 33. Dann errichtet man
in der Mitte der Geraden ein Lot,
dessen Länge gleich der Objektivbrennweite
ist, verbindet den Endpunkt des
Lots C mit den Endpunkten der Geraden
A B, so ist der Winkel A C B, welchen
die Verbindungslinien einschließen,
der Bildwinkel des Objektivs. |
 Einfache
Landschaftslinsen lassen einen nutzbaren
Bildwinkel von höchstens 30 - 40°
zu, Aplanate in der Regel einen solchen
von 40 - 50°, Anastigmate einen von
60 - 70°; Aplanate und Anastigmate,
die einen größeren Bildwinkel
umfassen, werden Weitwinkelobjektive
genannt; sie sind besonders für die
Aufnahme von Architekturen von Bedeutung;
der größte bisher erreichte Bildwinkel
beträgt 130°. äußerlich
kennzeichnen sie sich dadurch, dass ihr
Bau gedrungener, kürzer ist als der,
der sonstigen Objektive (vgl.
Bild 31
mit
Bild 21). Einfache
Landschaftslinsen lassen einen nutzbaren
Bildwinkel von höchstens 30 - 40°
zu, Aplanate in der Regel einen solchen
von 40 - 50°, Anastigmate einen von
60 - 70°; Aplanate und Anastigmate,
die einen größeren Bildwinkel
umfassen, werden Weitwinkelobjektive
genannt; sie sind besonders für die
Aufnahme von Architekturen von Bedeutung;
der größte bisher erreichte Bildwinkel
beträgt 130°. äußerlich
kennzeichnen sie sich dadurch, dass ihr
Bau gedrungener, kürzer ist als der,
der sonstigen Objektive (vgl.
Bild 31
mit
Bild 21).
Seite 14
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis zum
Stichwortverzeichnis
 Ein
Weitwinkelobjektiv ist natürlich
nur für die Plattengröße,
für welche es bestimmt ist, als Weitwinkel
zu betrachten. Verwendet man ein derartiges
Objektiv für eine kleinere Platte,
so kommt sein großer Gesichtswinkel
nicht zur Geltung, und es arbeitet genau
so wie jedes andere Objektiv. Ein
Weitwinkelobjektiv ist natürlich
nur für die Plattengröße,
für welche es bestimmt ist, als Weitwinkel
zu betrachten. Verwendet man ein derartiges
Objektiv für eine kleinere Platte,
so kommt sein großer Gesichtswinkel
nicht zur Geltung, und es arbeitet genau
so wie jedes andere Objektiv.
Der Zusammenhang zwischen
Brennweite, Plattengröße und
Bildwinkel ist aus folgender Tabelle zu
ersehen:
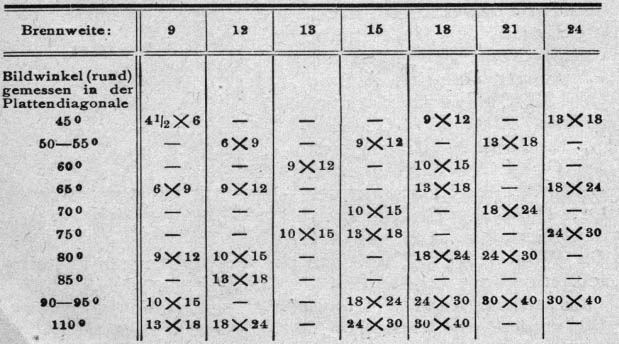
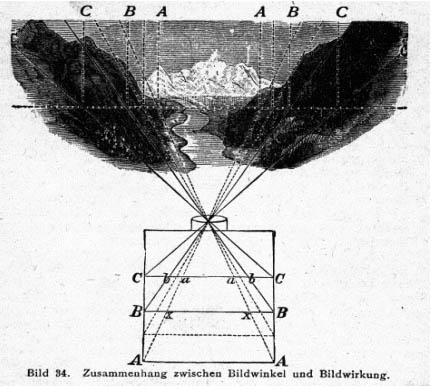 |
 Der
Einfluss, den der Bildwinkel auf
die Wirkung des Bildes hat, geht
aus Bild 34 hervor; es stellt eine
in der Zeichnung im Grundriss gedachte
(der Fachzeichner würde sagen:
herabgeschlagene) Kamera vor, in
die drei Objektive mit verschiedener
Brennweite eingesetzt wurden. Zunächst
nehmen wir ein Objektiv mit sehr
kurzer Brennweite (Auszug C C),
diese ist ungefähr halb so
lang wie die längste Seite
der Platte C C, es umfasse einen
Winkel von 110° (bzw. 90°,
nach der längsten Plattenseite
gerechnet). Solchen liefert nur
ein Weitwinkelobjektiv. B B stellt
den Auszug für ein Objektiv
mittleren Gesichtsfeld von 80°
(bzw. 60°, nach der längsten
Plattenseite gerechnet) dar, wo
die Brennweite = 4/5 der Plattenlänge
ist, die punktierte Linie darunter
gibt den Auszug für ein Objektiv,
dessen Brennweite gleich der Plattenlänge
ist, A A endlich den Auszug für
ein Objektiv mit F = 5/4 der Plattenlänge. |
Man erkennt nun aus den
punktierten Linien A A, B B, C C, welches
Bildfeld die verschiedenen Objektive von
der vorliegenden Landschaft liefern. Das
Bildfeld wird genau umschrieben, wenn man
in den Schnittpunkten der durch die Landschaft
in der Kamerahöhe gelegten Horizontalen
die punktierten senkrechten Linien zieht.
Man erkennt dann leicht, dass mit dem Objektiv,
dessen Brennweite nahezu gleich der halben
Plattenlänge ist das vollständige
Bild der seitlichen Talgehänge erhalten
wird. Das Objektiv, dessen Brennweite =
4/5 der Plattenlänge ist, liefert die
Platte in Stellung B B; hier fehlt ein Teil
der Seitengehänge des Tals, bei A A
(Brennweite = 5/4 der Bildlänge) kommen
nur die Berge im Hintergrund und diese nicht
einmal ganz. Aber ein Objektiv von F = 5/4
der Bildlänge hat den Vorteil, die
Gegenstände (ferne Berggruppe) am größten
wiederzugeben. Ein Objektiv mit F = ½
Plattenlänge gibt sie dagegen am kleinsten,
nämlich nur 2/5 so groß als ersteres.
Bei den anderen Objektiven steht die Gegenstandsgröße
im Verhältnis zur Brennweite.
Seite 15
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis zum
Stichwortverzeichnis weiter weiter
|